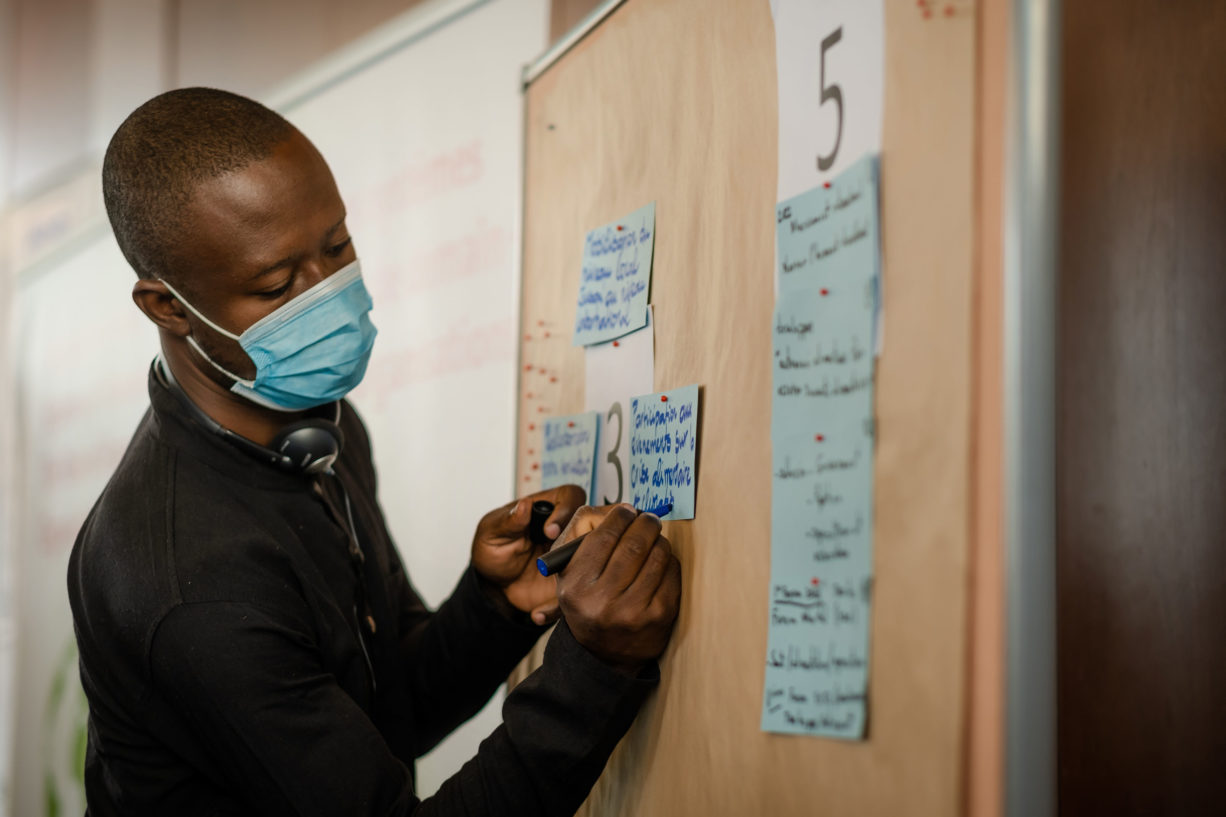Vom 3. -5 April kamen Repräsentantinnen und Repräsentanten nationaler, kontinentaler und globaler bäuerlicher Organisationen in Potsdam zusammen, um in den Austausch zu treten. Es war das erste Mal seit langem, seit prä-Pandemie, dass die Vertreterinnen und Vertreter sich persönlich austauschen und voneinander lernen konnten, Beziehungen wieder aufleben und neu schaffen konnten. In intensiven Workshopeinheiten beschäftigten sie sich mit Themen rund um die Rolle der organisierten Landwirtschaft in den Transformationsprozessen der Ernährungssysteme. Sie fragten sich: Wie funktioniert politische Interessenvertretung in diesen komplexen Prozessen? Wie schaffen wir es, die Heterogenität unserer Mitglieder gebündelt zu repräsentieren? Wie können wir sektorübergreifend zusammenarbeiten, mit dem Privatsektor, der Zivilgesellschaft und der Politik? Welche Aufgaben übernehmen wir bei der Umsetzung nationaler Ziele? Wo sind die Stellschrauben für die organisierte Landwirtschaft, um die Ernährungssysteme nachhaltiger und resilienter zu machen? Welche Ressourcen benötigen wir dafür? Und was bringen internationale Abkommen eigentlich?
Es wurde deutlich: Die organisierte Landwirtschaft funktioniert und handelt überall anders. Und doch einen sie die gleichen Herausforderungen. Die Teilnehmenden gaben zu, dass es schwierig ist, die divergierenden Interessen nicht nur ihrer eigenen Mitglieder, sondern auch zwischen den bäuerlichen Organisationen unter einen Hut zu bringen. Der kontinuierliche Dialog ist dafür unabdingbar. Doch gibt es auch einen nicht zu vernachlässigenden Anteil an Bäuerinnen und Bauern, die, freiwillig oder gezwungenermaßen, nicht Teil der organisierten Landwirtschaft sind. So zum Beispiel Frauen. Während sie in manchen Regionen mehr als die Hälfte der landwirtschaftlichen Arbeitskraft stellen, sind die wenigsten von ihnen Mitglied in einem Verband. Um also wirklich die Interessen der Landwirtschaft zu vertreten, müssen Frauen stärker eingebunden werden, waren sich die Repräsentantinnen und Repräsentanten einig.